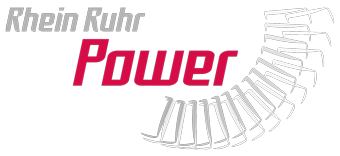Projekt-Kick-off am 20.07.2023 beim GWI mit Projektpartnern. V.l.n.r.: Marcel Biebl , Dr. Christoph Rosebrock, Dr. Tobias Löffler, Jonas Kaiser, Prof. Klaus Görner, Christoph Blöcher, Dr. Anne Giese, Dr. Dieter Förtsch, Dr. Peter Desskow, Dr. Michael Nolte, Dr. Ulrich Lohmann, Dr. Ingmar Gorges
Pressemitteilung
Das Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI) und die SAACKE GmbH starten ein Forschungsprojekt zur Nutzung von grünem Ammoniak (NH3) als klimafreundliche alternative zur Verbrennung fossiler Brennstoffe. Der Zuwendungsbescheid des Landes NRW ist erteilt.
Die Reduzierung der CO2-Emissionen, die Erreichung der Klimaziele, der Kohleausstieg, die Einbindung erneuerbarer Energien sowie die gleichzeitige Sicherstellung der Energieversorgungstellen stellen die großen Herausforderungen der nächsten Jahre dar. Gerade für NRW als einen der Standorte mit den energieintensivsten Industrien in Deutschland müssen alternative Konzepte entwickelt, ausgearbeitet und umgesetzt werden.
Im Rahmen des Projektes „Green-NH3 – CO2-neutraler Kessel“ werden die Möglichkeiten und Potenziale einer NH3-Nutzung in Kesselanwendungen geprüft und untersucht. Dazu gehören im ersten Teil die Grundlagenuntersuchungen, die Entwicklung eines schadstoffarmen Verbrennungssystems und die Übertragung auf reale Anlagen mit Hilfe von CFD-Simulationen.
„Das GWI kann hier sein großes Knowhow im Bereich der Industriefeuerung einbringen. So werden wir die Ammoniakzugabe an unseren Warmwasserkesseln und Hochtemperaturöfen unterschiedlicher Leistungsgrößen (20 kW – 200 kW) praxisnah untersuchen und analysieren“, erläutert Dr. Anne Giese, Abteilungsleiterin Industrie- und Feuerungstechnik beim GWI, den experimentellen Teil des Projektes.
Die Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf reale Anlagen erfolgt mittels CFD-Simulationen (CFD = Computational Fluid Dynamics), deren Ergebnisse mit vorhandenen Literaturdaten und bisherigen Messwerten verglichen und durch neue Messungen zur NOx– und N2O-Bildung erweitert werden, um eine umfassende Bewertung vornehmen zu können. Die resultierenden Erkenntnisse werden im Anschluss von der SAACKE GmbH verwendet, um aus den vorhandenen Prototypen ein serienreifes Brennersystem zu entwickeln.
Nach den Untersuchungen am GWI erfolgt im 2. Projektteil die großtechnische Umsetzung an einer Kesselanlage im industriellen Maßstab.
Der Einsatz von grünem Ammoniak kann vor allem für energieintensive Industrien, wie die Chemieindustrie, eine Alternative zu fossilen Brennstoffen, aber auch zu Wasserstoff, sein. Daher wird das Projekt in Zusammenarbeit mit der SAACKE GmbH durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert und von Currenta, Bayer und Covestro als assoziierte Partner unterstützt.
https://www.gwi-essen.de/das-gwi/aktuelles/gruener-ammoniak-ein-neuer-brennstoff-fuer-die-energieintensive-industrie/
Ansprechpartnerin:
Dr. Anne Giese
Abteilungsleiterin Industrie- und Feuerungstechnik
Gas- und Wärme-Institut Essen e.V.
Hafenstr. 101, 45356 Essen
anne.giese@gwi-essen.de
www.gwi-essen.de
Essen, 18. Juli 2023